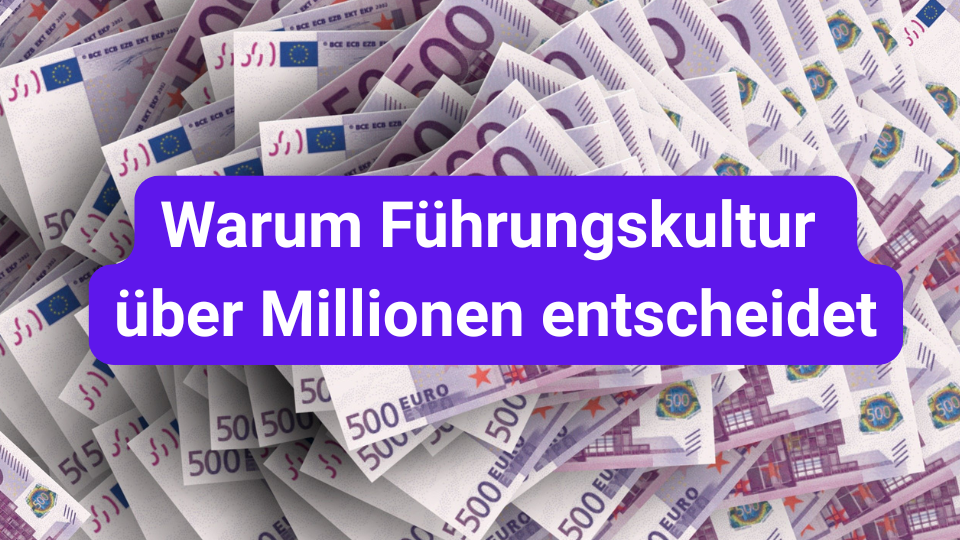Resonanzbasiertes Führen – warum ohne Verbindung nichts geht
Juni 24, 2025
Unterdrückte Emotionen im Team sind teuer – Stoppen Sie die Kostenfalle!
Juli 10, 2025Kaum ein Begriff wird in modernen Organisationen so zwiegespalten diskutiert wie Hierarchie. Die einen sehen sie als notwendiges Ordnungsprinzip, die anderen als Überbleibsel aus einer Zeit, in der formale Kontrolle, Gehorsam und Machtausübung zur Norm gehörten. Doch was ist dran?
Ist Hierarchie ein Relikt vergangener Zeiten – oder ein sinnvolles Strukturelement? Und wann wird sie toxisch?
Woher kommt Hierarchie eigentlich?
Hierarchien sind kein Produkt der Neuzeit. Bereits in antiken Militärsystemen, in Kirchenstrukturen und feudalen Herrschaftssystemen wurden Menschen in klaren Rängen organisiert. Der Ursprung des Wortes stammt aus dem Altgriechischen. Es setzt sich aus den Wörtern „hieros“ für „heilig“ und „archein“ für „herrschen, führen“ zusammen und bedeutete ursprünglich „Herrschaft der Heiligen“ oder „Priesterherrschaft“, bezeichnete also dereinst die Rangordnung in kirchlichen Strukturen.
In der Soziologie wird Hierarchie als System der Über- und Unterordnung beschrieben, das auf formalen Regeln basiert, also Rollen, Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse strukturiert. (wobei die Organisations-Soziologie, meine Lieblings-Wissenschaft sehr differenziert darauf blickt. Das würde hier zu weit führen.)
Hierarchien entstanden aus dem Wunsch nach Klarheit und Effizienz. Doch diese ursprüngliche Idee ist vielerorts entartet: Heute existieren Hierarchien vor allem deshalb, weil man es schon immer so gemacht hat – nicht unbedingt, weil sie noch funktionieren.
Leitthese: Hierarchien sind nicht das Problem. Sinnlose Titelvergabe ohne innere Führungsreife ist das Problem.
Woran Hierarchien scheitern
„Mit dem Chef brauche ich gar nicht reden – der hört mir eh nicht zu.“ „Mein Chef ist gar kein richtiger Chef. Der hat den Titel bekommen, weil es irgendwann Zeit war, ihn zu befördern.“ „Meeting sind bei uns in der Regel Business-Theater. Chef redet, wir spielen Bullshit-Bingo.“
Solche und ähnliche Sätze wie diese begegnen mir in Unternehmen oft. Und sie zeigen das eigentliche Problem: Hierarchie macht keinen Sinn, wenn sie als Belohnungssystem fungiert. Wenn Titel vergeben werden, um Zugehörigkeit zu honorieren – nicht, weil jemand Verantwortung tragen oder Menschen führen kann. Und Hierarchien machen keinen Sinn, wenn der „Chef“ überhaupt nicht ernst genommen werden kann. Wann ist das der Fall?
- Titel statt Verantwortung: Rollen werden vergeben, um Loyalität zu belohnen, nicht um Klarheit zu schaffen. Wer viele Jahre dabei ist, wird automatisch „Teamleiter“ – ungeachtet von Eignung oder Wirksamkeit. Oder unliebsame Posten werden vice versa als Bestrafung vergeben bzw. jemand wird „kalt gestellt“.
- Machtspiele: Mitarbeiter gehen zum „Chef-Chef(-Chef)“, weil sie sich beim direkten Vorgesetzten nicht gesehen fühlen. Der „Chef-Chef(-Chef)“ mischt sich direkt ein und übergeht alle Ebenen. Das Ergebnis: Verwirrung, Vertrauensverlust und Chaos.
- Silos statt Teams: Bereichsleiter arbeiten nebeneinander statt miteinander. Jeder optimiert seinen Bereich, aber keiner das Ganze. Verantwortung wird nicht geteilt, sondern verteidigt.
- Missbrauch von Macht: Einzelne fühlen sich sicher genug, um aus dem Hafen ihres Status heraus Entscheidungen zu treffen, die anderen schaden – Hauptsache, der eigene Bereich profitiert.
- Kein sicherer Anlaufpunkt: Mitarbeitende wissen nicht, an wen sie sich bei Unsicherheit wenden sollen. Die Hierarchie wirkt wie ein undurchdringliches Geflecht aus Ego, Angst und Politik. Im schlimmsten Fall traut sich keiner mehr irgendetwas zu sagen aus Angst vor systemischen Gegenschlägen.
„Moderne Führung braucht keine Ketten aus Hierarchiestufen – sondern Räume für Resonanz, Klartext und Verantwortung.“
Realität in Start-ups: Wenn Titel alles sind
In Start-ups beispielsweise begegnen wir Hierarchie in einer ganz anderen Zerrform: flache Strukturen, agile Teams und recht freie Arbeitsstrukturen treffen auf vielumworbene, rare Führungsposten auf der VP-Ebene für Menschen, die vor allem eines gut können: sich selbst verkaufen.
In einem Start-up, das ich beraten habe, war die VP-Ebene das reinste Chaos. Jeder agierte für sich, es ging um Status, Gehalt und Einfluss. Nicht selten mit dem Ziel, möglichst lange zu überleben, um die eigenen Unternehmensbeteiligungen einzulösen. Die Konsequenz:
- Die Führungsebene war so mit sich selbst beschäftigt, dass an der Basis keinerlei Halt oder Struktur mehr spürbar war.
- Mitarbeitende verloren Orientierung, begannen selbst strategisch zu taktieren, statt sich auf gemeinsame Ziele zu konzentrieren.
- Es entstand eine Kultur des Selbsterhalts statt der Zusammenarbeit.
Hierarchie ohne Haltung wird zur Bühne für Ego-Spiele. Da helfen auch keine flexiblen Arbeitsmodelle und eine angeblich so positive „Startup-Kultur“ – der Deckmantel für „Du arbeitest Dich halb tot, weil du vielleicht irgendwann doch noch reich wirst, wenn das Ding durch die Decke geht.“ Und das ist Gift für jede Organisation, die wachsen will.
Und im Konzern? Wenn Strukturen lähmen
Während in Start-ups oft die Bühne zählt, sind es im Konzern die Prozesse, die lähmen. Klassische Konzernstrukturen saugen Energie – nicht durch offene Machtspiele, sondern durch Regelkonformität, Trägheit und kreative Erstarrung.
- Entscheidungen werden vertagt, weil „es nicht im Prozess vorgesehen ist“.
- Führungskräfte achten mehr auf die Einhaltung von Vorgaben als auf die Qualität der Beziehung.
- Mitarbeitende verbringen mehr Zeit mit Dokumentation, Abstimmungen und Absicherungen als mit echter Wertschöpfung.
- Korinthenzählerei ersetzt Verantwortung.
Das Ergebnis? Kreativität geht verloren. Initiative versickert. Und statt lebendiger Führung entsteht Verwaltung von Menschen. Darin lässt es sich als Low-Perfomer perfekt verstecken, geschützt durch die Arbeitsschutzgesetze und den betriebswirtschaftlichen Beistand. Alles Regularien, die Machtmissbrauch, Unterdrückung und Ungerechtigkeit unterbinden sollen.
Der negative Beigeschmack fehlgeleiteter Hierarchie – nur in grauem statt buntem StartUp Gewand.
Was heißt das für Karrierepfade?
In vielen Organisationen werden Karrierepfade in aufwendigen HR-Prozessen entwickelt. Es wird genau festgelegt, wer welche fachlichen Kompetenzen benötigt, um die nächste Stufe auf der Karriereleiter zu erreichen. Ein unfassbar teuerer, zeitintensiver Vorgang. Was dabei oft zu kurz kommt: die emotionale, psychologische und soziale Entwicklung der Führungskraft.
„In den meisten Unternehmen werden heute noch Menschen befördert, die Projekte gut managen – nicht Menschen, die Menschen gut führen.“
Es reicht natürlich nicht mehr aus, Projekte zu managen oder Prozesse zu beherrschen. Eine Führungskraft muss in der Lage sein, mit Menschen in Verbindung zu gehen. Mehr denn je, weil die Unsicherheit, Komplexität und Verwirrung in den Köpfen immer größer wird. Sie muss erkennen, wo Mitarbeitende stehen, wie man psychologische Sicherheit schafft und welche Haltung Vertrauen fördert.
Diese Kompetenzen stehen zwar in Anforderungsprofilen – aber sie werden kaum systematisch gefördert oder knallhart bewertet. Wer aus Karrierepfaden wirkungsvolle Führungswege machen will, muss hier neue Prioritäten setzen – und zwar von ganz oben, denn nur dann, wenn selbst der Vorstand nach diesen Maßstäben bewertet wird, macht es für den Teamleiter an der Basis Sinn, sich ebenfalls zu bewegen. Der Schlüssel liegt in der Entwicklung der inneren Haltung, nicht im bloßen Aufstieg.
„Solange Karrierepfade nicht systematisch emotionale Intelligenz, Konfliktfähigkeit und Resonanzfähigkeit fördern, bleiben sie hierarchische Treppen – aber keine Wege echter Wirksamkeit.“
Warum verändert sich so wenig?
Wenn Hierarchie im eigenen Unternehmen toxisch (= unproduktiv, ineffizient, Silo-fördernd, ungerecht, abwertend, sinnbefreit, teamspaltend) wirkt – warum ändern so wenige Organisationen ihre Strukturen?
- Weil Macht nicht freiwillig abgegeben wird.
- Weil Kontrolle sich sicherer anfühlt als Vertrauen.
- Weil es an echten Alternativen mangelt.
- Und weil emotionale Reife nicht im KPI-System messbar ist.
Doch genau das wird in Zukunft über Erfolg oder Stillstand entscheiden: Die Fähigkeit, menschlich zu führen. Nicht nur von oben nach unten, sondern durch echte Verbindung auf allen Ebenen.
Wann Hierarchie sinnvoll ist
Hierarchie macht Sinn, wenn sie funktional gedacht ist:
- Als Orientierungsstruktur: Wer entscheidet was? Wer übernimmt Verantwortung in kritischen Situationen? Wenn transparent und klar kommuniziert wird und eine kollektive Intelligenz gefördert wird.
- Als psychologisches Sicherheitsnetz: Menschen brauchen Ansprechpartner als Haltepunkte. Ein gutes System schafft Sicherheit und baut aufeinander auf, statt sich gegenseitig zu behindern.
- Als Leitung im wörtlichen Sinne: Leitung heißt nicht Kontrolle, sondern Richtung geben, Fokus halten, Energie bündeln, zuhören und unterstützen.
Ein Chef ist nicht dazu da, um zu regieren. Sondern um:
- zu halten, wenn es wackelt,
- zu klären, wenn es chaotisch wird,
- zu ordnen, wenn Teams sich verlieren,
- und zu verbinden, wenn Misstrauen entsteht.
Psychologie und Hierarchie
Studien zeigen, dass Menschen in unsicheren Situationen tendenziell nach Orientierung suchen. Der Psychologe Abraham Maslow hat bereits in seiner Bedürfnishierarchie „Sicherheit“ als fundamentale Voraussetzung für Entwicklung beschrieben. Ohne ein kluges Mindestmaß an Struktur entsteht kein Vertrauen, keine Resonanz, keine Innovation.
Doch Struktur heißt nicht starr. Was Menschen brauchen, ist Verantwortungsübernahme auf Augenhöhe. Nicht Hierarchie als Machtmittel, sondern als Resonanzraum, der flexibel mitschwingt.
Deep Human Leadership: Die Alternative
In einer resonanzbasierten Führungskultur ist nicht die Position entscheidend, sondern die Wirkung. Hierarchie ist kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug. Es braucht:
- Präsenz: Wer führt, muss spürbar sein. Nicht laut, sondern da.
- Resonanz: Echte Verbindung zwischen Führungskraft und Team.
- Klartext: Keine Spielchen, sondern klare Sprache.
- Stabilität: Nicht Dominanz, sondern Sicherheit geben.
Hierarchie ist also kein Relikt – aber sie muss sich wandeln. Sie muss dienen, nicht herrschen. Halt geben, nicht unterwerfen. Und sie muss so gestaltet sein, dass sie psychologische Sicherheit fördert, nicht untergräbt. Und das ist der Kern des Umdenkens.
Vielleicht ist nicht die Frage, ob wir Hierarchie brauchen. Sondern wie wir sie gestalten. Und welchen Preis wir bereit sind zu bezahlen. Führungskräfte müssen nicht auf ihre Goodies verzichten, aber sie müssen sich von Machtbedürfnissen und blockierenden Denk- und Handlungsweisen lösen.
👉 Welche Erfahrungen hast du mit Hierarchie gemacht? Wann hast du sie als hilfreich erlebt – und wann als hinderlich?
Wenn du nicht mehr nur Karriere machen willst – sondern echte Wirkung entfalten willst, dann sollten wir sprechen.
Einblick in Organisationssoziologie für Stöberer: http://www.sozialstruktur.uni-oldenburg.de/dokumente/orgein.pdf
Tolles Kapitel über Vertrauen. Lesenswert ab Seite 8: https://d-nb.info/963713183/34
„Setzen wir also zunächst einmal die These voraus, dass wir uns auf dem Weg in die postindustrielle und postmoderne Wissens- und Informationsgesellschaft befinden, dann liegt es vor allem nahe, Begriffe wie Komplexität, Unsicherheit, Unüberschaubarkeit und Turbulenz zu benutzen. In diesem Zusammenhang stellt die Riege der Unternehmer und Manager in der Arbeitswelt fest, dass sie mit ihren hergebrachten Formen von Macht und Autorität nicht mehr alle Prozesse unter Kontrolle bringen können.“
Über die Autorin
Malaika Loher begleitet seit 20 Jahren Führungskräfte, Teams und Organisationen in Veränderungsprozessen. Sie ist Expertin für resonanzbasierte Führung, tiefe Teamdynamik und psychologische Sicherheit. Ihre Arbeit verbindet fundierte systemische Beratung, unternehmerisches Denken und die Fähigkeit, Menschen wirklich zu sehen – jenseits von Rollen und Status.
Mit ihrem Konzept Deep Human Leadership schafft sie Räume, in denen echte Verbindung entsteht, Klartext gesprochen werden darf und Führung sich nicht auf Hierarchie verlässt – sondern auf Präsenz, Haltung und Wirkung.